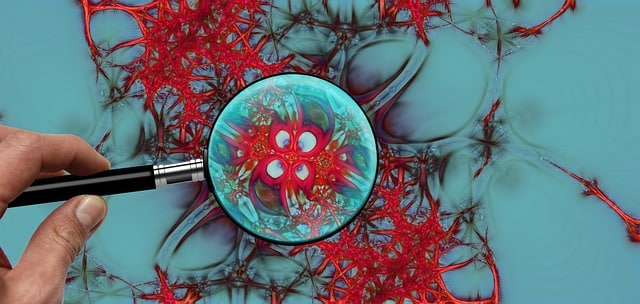
Die Polyvagale Theorie – Ein Schlüssel zum Verständnis von Sicherheit und Trauma
Die Polyvagale Theorie, entwickelt von Dr. Stephen Porges, bietet einen tiefgehenden Einblick in die Funktionsweise unseres Nervensystems und dessen Einfluss auf unser Verhalten, unsere Emotionen und unsere Gesundheit. Diese Theorie erklärt, wie unser Nervensystem auf Herausforderungen und Bedrohungen reagiert und welche Rolle das Gefühl von Sicherheit dabei spielt.
Was ist die Polyvagale Theorie?
Im Kern beschreibt die Polyvagale Theorie die Funktionsweise des autonomen Nervensystems, insbesondere des Vagusnervs. Der Vagusnerv ist ein Hauptnerv, der sich vom Gehirn über den Körper bis in verschiedene Organe erstreckt. Er steuert nicht nur viele körperliche Funktionen wie Herzschlag und Atmung, sondern auch, wie wir auf Stress reagieren.
Laut der Polyvagalen Theorie gibt es drei grundlegende Zustände oder „Zweige“ des autonomen Nervensystems:
Der ventral-vagale Zustand (soziale Verbundenheit): In diesem Zustand fühlen wir uns sicher, entspannt und sozial verbunden. Wir können klar denken, mit anderen interagieren und uns kreativ entfalten. Der ventrale Vagus ist aktiv, wenn wir in einer sicheren Umgebung sind.
Der sympathische Zustand (Kampf- oder Fluchtmodus): Wenn unser Nervensystem eine Bedrohung wahrnimmt, aktiviert sich der sympathische Zweig. Dies löst die Kampf- oder Fluchtreaktion aus: Der Puls steigt, die Atmung wird schneller, und wir bereiten uns darauf vor, zu handeln oder zu fliehen.
Der dorsal-vagale Zustand (Shutdown oder Erstarrung): Bei überwältigenden Bedrohungen schaltet unser Nervensystem in einen Überlebensmodus, der durch Erstarrung oder ähnliche Reaktionen gekennzeichnet ist. Dieser Zustand wird durch den dorsalen Vagus aktiviert und kann sich wie eine emotionale oder körperliche „Abschaltung“ anfühlen.
Wie entwickelt sich unser Sicherheitsgefühl?
Die Polyvagale Theorie betont, dass das Gefühl von Sicherheit für unser Wohlbefinden von zentraler Bedeutung ist. Dieses Gefühl wird nicht nur durch unsere Umwelt beeinflusst, sondern auch durch unsere zwischenmenschlichen Beziehungen. Ein beruhigender Gesichtsausdruck, ein freundlicher Tonfall oder eine sanfte Berührung können das Nervensystem beruhigen und uns in den ventral-vagalen Zustand bringen. Umgekehrt können bedrohliche Signale – laute Geräusche, plötzliche Bewegungen oder kalte, distanzierte Interaktionen – unser Nervensystem in Alarmbereitschaft versetzen.
Polyvagale Theorie und Trauma
Trauma spielt eine zentrale Rolle in der Polyvagalen Theorie. Bei Menschen, die traumatische Erfahrungen gemacht haben, kann das Nervensystem überempfindlich auf Bedrohungen reagieren. Sie können Schwierigkeiten haben, in den ventral-vagalen Zustand zurückzukehren, und bleiben oft im sympathischen (Kampf-/Flucht) oder dorsalen (Erstarrung) Modus stecken.
Diese dysfunktionalen Zustände können sich in Symptomen wie Angst, Depression, Dissoziation oder chronischen Schmerzen äußern. Die Polyvagale Theorie hilft, diese Zustände zu verstehen, und bietet eine Grundlage für therapeutische Ansätze, die darauf abzielen, das Nervensystem zu regulieren.
Wege zur Regulation des Nervensystems
Die gute Nachricht ist, dass das Nervensystem durch gezielte Übungen und Interventionen wieder in Balance gebracht werden kann. Einige Ansätze, die auf der Polyvagalen Theorie basieren, umfassen:
Atemübungen: Langsame, tiefe Atmung kann den ventral-vagalen Zustand aktivieren und das Nervensystem beruhigen.
Soziale Verbundenheit: Zeit mit vertrauten, unterstützenden Menschen zu verbringen, kann das Gefühl von Sicherheit stärken.
Bewegung: Sanfte Bewegungen wie Yoga, Tanzen oder Spazierengehen helfen, Anspannungen abzubauen.
Körpertherapie: Techniken wie Somatic Experiencing oder EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) können dabei helfen, traumatische Erinnerungen zu verarbeiten und das Nervensystem neu zu regulieren.
Fazit
Die Polyvagale Theorie bietet einen revolutionären Ansatz, um zu verstehen, wie unser Nervensystem auf Sicherheit und Bedrohung reagiert. Sie zeigt, dass unser Verhalten nicht einfach „an” oder „aus“ ist, sondern von subtilen inneren Mechanismen gesteuert wird. Dieses Verständnis kann nicht nur bei der Behandlung von Trauma helfen, sondern auch unseren Alltag bereichern, indem wir lernen, unsere Reaktionen bewusster wahrzunehmen und zu regulieren.
Wenn wir uns mit der Polyvagalen Theorie auseinandersetzen, entdecken wir, dass Heilung möglich ist – durch die Stärkung unseres Sicherheitsgefühls, durch liebevolle Beziehungen und durch die Wiederentdeckung unserer inneren Balance.





